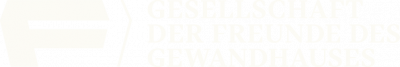Bassetthorn – das Instrument der Wiener Klassik
Etwa um 1760 entstanden, erlebte dieses Klarinetten-Instrument eine kurze Blütezeit in der Wiener Klassik.
Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch Carl Stamitz und später von Felix Mendelssohn Bartholdy verwenden es. Der Altklarinette ähnlich zeichnet sich das Bassetthorn durch die Erweiterung des Tonumfangs in der tiefen Lage und durch einen besonders warmen Klang aus.
Abbildung:
Bassetthorn von
Jakob Friedrich Grundmann, 1787,
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Richard Strauss ist die Renaissance des Instruments durch dessen Verwendung in einigen seiner Opern zu verdanken, sodass auch Komponisten des 20. Jahrhunderts wieder Gebrauch vom Bassetthorn machten (Karlheinz und Markus Stockhausen, Bernd Alois Zimmermann, Georg Benjamin, Peter Schat).
Der Name Bassetthorn hat seinen Ursprung vermutlich im italienischen bassetto, kleiner Bass, von der gebogenen Form und dem Trichter, der sehr an das Schallstück des Horns erinnert.
Wolfgang Amadeus Mozart verwendete Bassetthörner in mehreren Werken, solistisch wie im Orchester. In der Entführung (Arie der Constanze), in der Arie des Figaro (Al desio) und im Titus (Arie der Virellia) tritt das Bassetthorn mit solistischen Einlagen hervor. In der Zauberflöte und im Requiem werden – wohl am bekanntesten – zwei Bassklarinetten im Orchestersatz eingesetzt.
 In Beethovens Ballett Die Geschöpfe des Prometheus gibt es ein virtuoses Solo für das Bassetthorn. Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte zwei brillante Konzertstücke mit Bassetthorn, die er den berühmten Klarinettisten Baermann, Vater und Sohn, widmete. Schließlich setzte Richard Strauss das Bassetthorn zur Vervollständigung der Klarinettenfamilie in Elektra ein, so, wie er zuvor auch schon mit dem Heckelphon in Salome die Oboenfamilie vervollständigte.
In Beethovens Ballett Die Geschöpfe des Prometheus gibt es ein virtuoses Solo für das Bassetthorn. Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte zwei brillante Konzertstücke mit Bassetthorn, die er den berühmten Klarinettisten Baermann, Vater und Sohn, widmete. Schließlich setzte Richard Strauss das Bassetthorn zur Vervollständigung der Klarinettenfamilie in Elektra ein, so, wie er zuvor auch schon mit dem Heckelphon in Salome die Oboenfamilie vervollständigte.